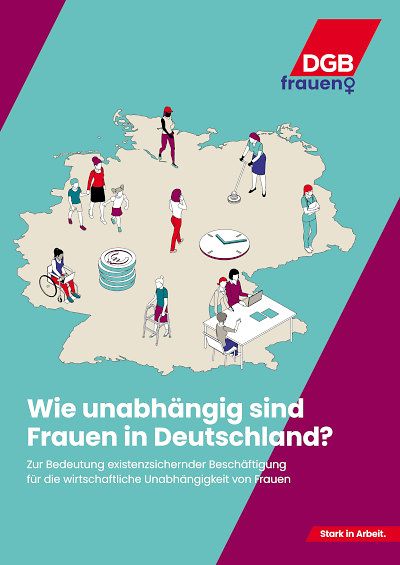
Um selbstbestimmt leben zu können, muss man wirtschaftlich unabhängig sein. Daher kommt dem eigenen Beruf und dem eigenen Einkommen eine hohe Bedeutung zu. Aber bei vielen Frauen ist das Einkommen nicht hoch genug, um damit die eigene Existenz unabhängig von einem Partner, einer Partnerin, den Eltern oder von staatlichen Leistungen langfristig zu sichern. Für echte wirtschaftliche Unabhängigkeit ist es wichtig, dass die eigene Existenz nicht nur kurzfristig gesichert ist, sondern langfristig über den gesamten Lebensverlauf. Das heißt, ein Einkommen muss nicht nur für den aktuellen Monat ausreichen. Es muss auch in veränderten Lebenssituationen wie Scheidung, Trennung oder Verlust für eine ausreichende soziale Absicherung sorgen. Die Broschüre „Wie unabhängig sind Frauen in Deutschland?“ wird vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) herausgegeben und untersucht die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen in Deutschland.
Ob Frauen einer existenzsichernden Beschäftigung nachgehen können und damit langfristig eigenständig abgesichert sind, hängt von vielen Faktoren ab, die oft nicht individuell beeinflussbar sind.
Die Mehrheit der Frauen in Deutschland ist ökonomisch nicht eigenständig
Die Autorin der Broschüre, Irene Pimminger, hat für die Agentur für Gleichstellung im Europäischen Sozialfonds (ESF) ein Konzept und Berechnungsmodell entwickelt. Die vorgestellten Inhalte und Berechnungen beruhen darauf und kommen zu folgenden Ergebnissen:
- Über die Hälfte der erwerbstätigen Frauen in Deutschland (53 Prozent) kann mit ihrem eigenen Einkommen ihre Existenz nicht über den gesamten Lebensverlauf absichern.
- Noch schwieriger ist die Situation, wenn Kinder ins Spiel kommen: 70 Prozent der erwerbstätigen Frauen verdienen nicht genug, um langfristig für sich und ein Kind vorzusorgen. Das bedeutet, dass sie in Phasen der Erwerbslosigkeit – sei es durch Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit oder im Ruhestand – nicht ausreichend abgesichert sind.
Die Ursachen sind in der Regel keine individuellen Entscheidungen der Frauen, sondern häufig das Resultat struktureller Rahmenbedingungen, die Frauen in die wirtschaftliche Abhängigkeit drängen.
Frauen unterbrechen häufiger ihre Erwerbstätigkeit
Frauen unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger als Männer. Dies liegt oftmals an der Übernahme von Betreuungs- und Pflegeaufgaben innerhalb der Familie. Diese Unterbrechungen haben jedoch langfristige negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation von Frauen. Dies zeigt sich insbesondere im Alter, da die Unterbrechungen zu geringeren Rentenansprüchen führen.
Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit
Ein großer Teil der erwerbstätigen Frauen arbeitet in Teilzeit. Diese Arbeitszeitmodelle ermöglichen es Frauen häufig, ihre familiären Verpflichtungen zu erfüllen. Sie führen jedoch zu einem deutlich geringeren Einkommen und einer unzureichenden sozialen Absicherung. Dies wiederum hat negative Folgen für die wirtschaftliche Unabhängigkeit und Altersvorsorge von Frauen.
Frauen verdienen durchschnittlich weniger als Männer
Der durchschnittliche Stundenlohn von Frauen liegt immer noch etwa 16 Prozent unter dem von Männern. Diese Lohnlücke resultiert aus einer Vielzahl von Faktoren, wie zum Beispiel dem Frauenanteil in Führungspositionen, der Berufswahl und Bewertungsunterschieden zwischen männlich und weiblich dominierten Berufen. Die niedrigeren Löhne tragen erheblich dazu bei, dass viele Frauen nicht aus eigener Kraft wirtschaftlich unabhängig sind.
Ein erheblicher Anteil der Frauen verdient weniger als das notwendige Einkommen zur Sicherung der Existenz. Laut den Berechnungen der Broschüre liegt das Einkommen von etwa 21 Prozent der Frauen im Haupterwerbsalter aus abhängiger Beschäftigung unter dem Existenzminimum für eine alleinstehende Person. Dies bedeutet, dass viele Frauen trotz Erwerbstätigkeit auf zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen sind.
Gender Pension Gap
Frauen haben im Schnitt deutlich niedrigere Rentenansprüche als Männer. Dieser Gender Pension Gap ergibt sich aus den häufiger und länger dauernden Erwerbsunterbrechungen sowie der überwiegenden Teilzeitbeschäftigung. Laut den Berechnungen des DGB erhalten Frauen, die 2022 in den Ruhestand traten, eine gesetzliche Rente, die im Durchschnitt nur halb so hoch ist wie die der Männer.
Worauf sollten Frauen selbst achten?
Für Frauen ist die eigene Altersvorsorge besonders wichtig. Die Verdienstaussichten sollten daher auch schon bei der Berufswahl berücksichtigt werden. Eine Berufsausbildung oder ein Studium erhöhen die Chancen auf ökonomische Eigenständigkeit. Zudem liegt in der Arbeitsteilung innerhalb der eigenen Familie das Potenzial für eine Entlastung, die die finanziellen Folgen einer Scheidung oder Trennung abfedern kann. Denn je partnerschaftlicher die Aufteilung der Care-Arbeit erfolgt, desto stärker können sich auch Frauen bzw. Mütter um ihre langfristige Existenzsicherung kümmern. Auch Entscheidungen für steuerliche Vorteile wie das Ehegattensplitting, Teilzeitarbeit oder die Aufnahme eines Minijobs können sich kurzfristig scheinbar lohnen – haben in langfristiger Perspektive aber negative Auswirkungen auf die eigenständige Existenzsicherung.
Das DGB-Projekt „Was verdient die Frau? Mehr Geld, Zeit & Respekt“ wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.